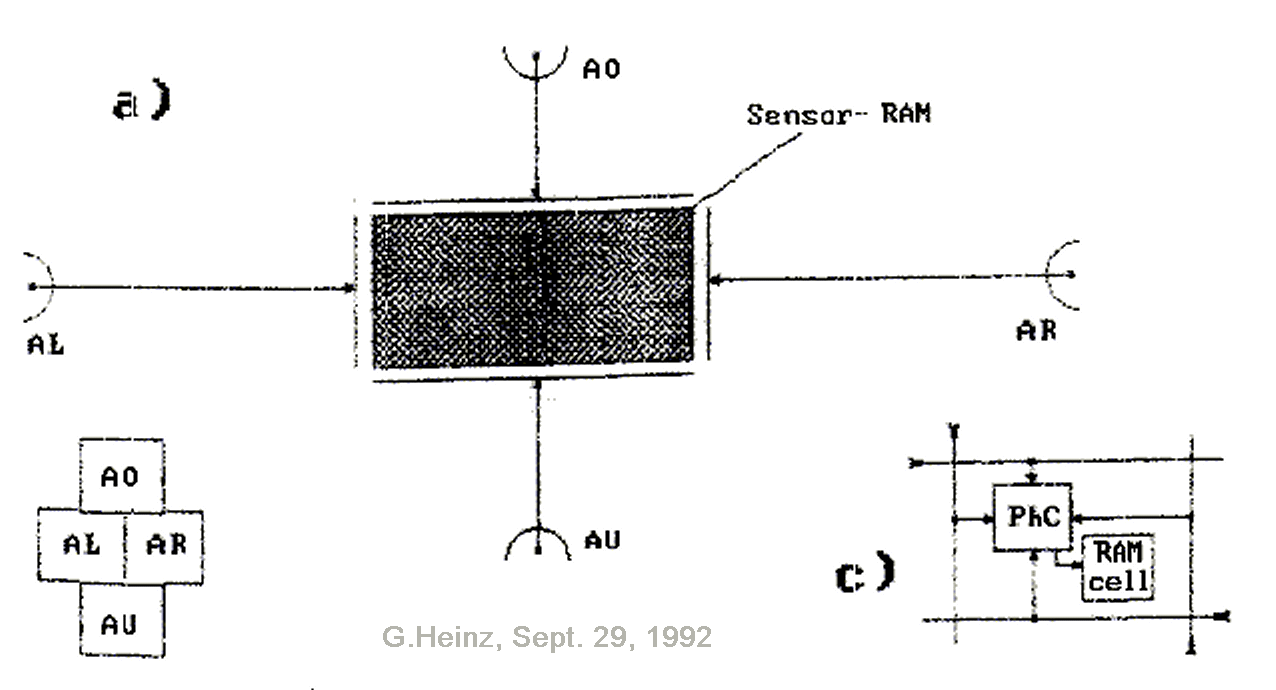
Um die Grundidee der spiegelverkehrten Abbildungen nervlicher Netze zu verstehen, ist es hilfreich, sich an die Geschichte der Geburt der Interferenznetze zu erinnern.
Ende September 1992 zogen nachts erste Nebelbänke auf. Soweit ich mich erinnere, kamen eines Nachts im dichten Nebel viele Menschen bei einem Busunfall ums Leben. Eine technische Idee, dies zu vermeiden, ist die Entwicklung eines bildgebenden Impulsradars für LKW und Busse.
Für bildgebende Systeme ist das alte Prinzip eines rotierenden RADARs mit Einzelempfänger und -sender nicht geeignet. Anstelle einer rotierenden Antenne werden hier vier feste Antennen verwendet, die an der Vorderseite des Busses oder LKWs angebracht werden.
Die Idee: Zur Bilderzeugung könnte man vier eingehende Antennendatenströme in entgegengesetzte Richtungen über ein Detektorfeld lenken, Abb.1. So einfach die Idee scheint, so komplex erscheint deren Umsetzung.
Wollen wir das Bild auf 1 Zentimeter auflösen, so kommen wir in den Frequenzbereich oberhalb von 30 GHz. Damit sind Leiterplattenlösungen ausgeschlossen, ein IC wäre zu entwickeln für hunderttausende Mark.
NR: c = s/t = s·f; f = c/s = 300.000 km/s / 0,01 m = 30 GHz; 1/f = 33ps
Recherchen zeigten nun, dass es nicht einfach ist, solch ein System zu berechnen. Mir fehlte zunächst das Werkzeug, um Gleichungen in akzeptabler Zeit zu lösen.
Deshalb las ich Bücher über Optik und Welleninterferenz [1] sowie über Radarsysteme [2], [3], um die Physik und Mathematik pulsausbreitender Interferenzsysteme zumindest teilweise zu verstehen. (Daraus entstand später PSI-Tools, um Interferenzsysteme mit vielen Kanälen zu simulieren.)
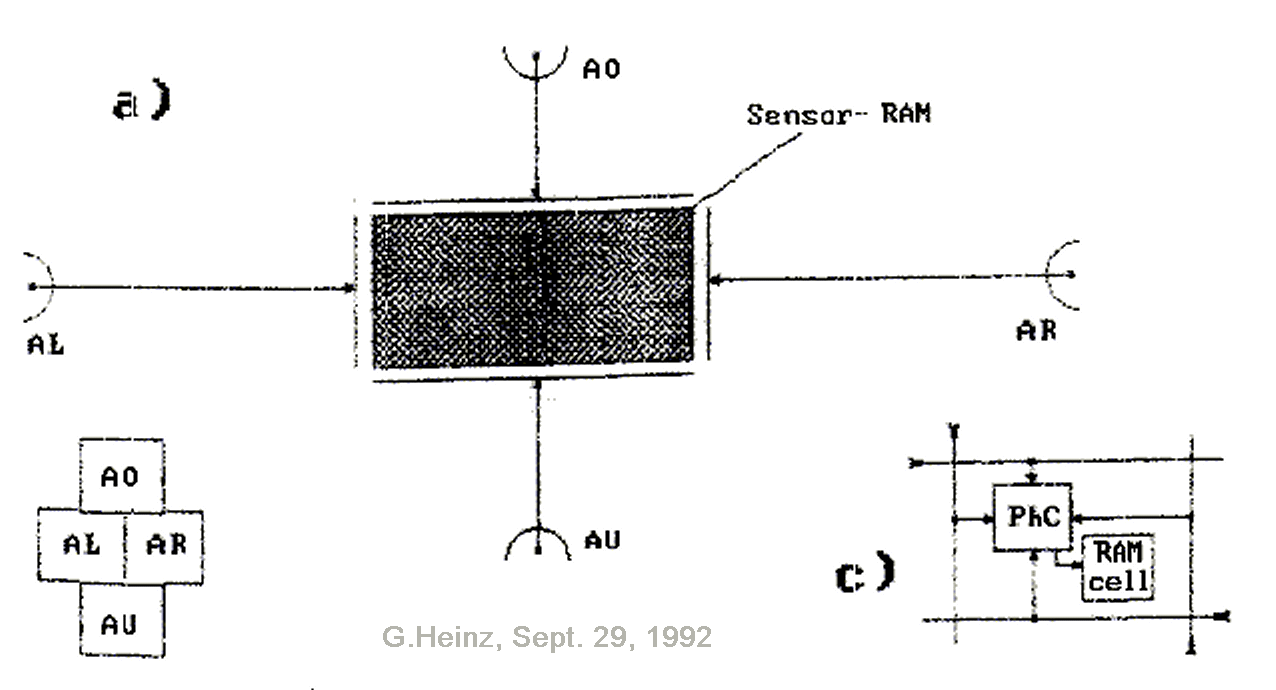
Abb. 1: a) Schematische Darstellung des Empfängers für (Puls-) Radarbilder vom 29. September 1992. c) Einzelne Detektorzelle. (PhC: Phasenkomparator als 4-fach AND. Ax: Antenne oben O, unten U, links L, rechts R). Jeder Phasenkomparator sollte eine Anzeige-LED treiben. Da eine (doppelt) spiegelverkehrte Projektion empfangen wird, wären die Antennenkabel für oben/unten und links/rechts zu vertauschen.
Nach einigen Überlegungen schien ein spezielles Ergebnis solcher Interferenzbilder vorhersehbar zu sein: Der einzige wählbare Interferenzort ist der Punkt gleicher Verzögerungen auf allen möglichen Signalwegen. Nur an diesem Interferenzpunkt ist es möglich, die höchste Anregung zu erreichen, beispielsweise mit multiplizierenden AND-Gattern (PhC).
Dieser Ort aber liegt dem Ursprung diagonal gegenüber. Es entsteht folglich ein spiegelverkehrtes Abbild - genauer ein Abbild ist mit der Raumdimension d gespiegelt. Ein zweidimensionales Bild ist folglich zweifach gespiegelt, ein n-dimensionales n-fach.



Abb. 2: Zur Doppelspiegelung einer 2-dim. Interferenzprojektion: vlnr Original; oben/unten vertauscht; oben/unten und links/rechts vertauscht.
Je mehr Schaltungen analysiert wurden, desto deutlicher wurden drei Eindrücke:
Bei der Recherche in Büchern zur Neuroanatomie stieß ich auf eine Arbeit über gespiegelte, topografische Karten im menschlichen Gehirn, zum Beispiel Penfields sogenannten "Homunkulus". Es schien reiner Zufall zu sein, dass diese virtuell gespiegelten Radarbilder dieses Verhalten reproduzierten.
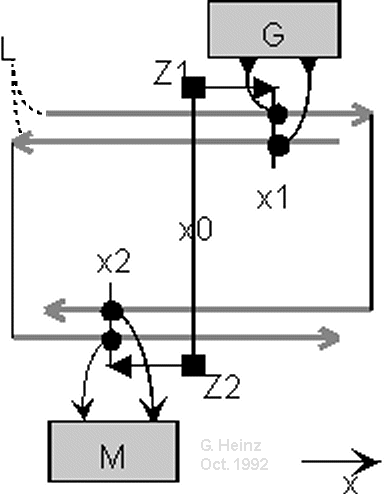
Abb. 3: Eindimensionale Interferenzprojektion. Eine Anregung auf der Seite G erzeugt eine gespiegelte Interferenzposition auf der anderen Seite M (Schaltkreis erstellt im Oktober 1992). Beachten Sie den Hauptunterschied zu elektrischen Schaltkreisen: Leitungen L haben andere Aufgaben. Leitungen in Interferenzschaltungen sollen dämpfungsfrei sein, haben aber eine Übertragungsgeschwindigkeit. Sie sind keine Knoten, die dazu konstruiert sind, Ströme zu leiten oder Lasten anzutreiben. Vergleichbar mit Nerven symbolisieren sie den gerichteten Fluss von Zeitfunktionen von und zu verschiedenen Punkten mit definierten Geschwindigkeiten oder Verzögerungen.
Mit der Entwicklung des "Bio-Interface" (PSI-Tools) waren wir in der Lage, seit August 1994 Interferenzphänomene in der Simulation zu untersuchen. Das Hauptinteresse gilt der Bio-neuronalen Informatik: Die Theorie zeigt, dass Forschungen in diesem Bereich mehrkanalige Datenströme und Interferenztheorie im Allgemeinen benötigen. In diesem Bereich sind Interferenz- Berechnungen unverzichtbar, um Erkenntnisse über neuronale Kommunikation zu gewinnen.
Im Bereich der industriellen Anwendbarkeit können Ultraschallgeräte mit verbesserten Abbildungsmöglichkeiten für medizinische und Materialbildgebungszwecke simuliert werden.
Für Freifeldanwendungen in der Luft eignet sich der Interferenzassistent zur Lautstärkelokalisierung in den Bereichen Motor-/Maschineninspektion, Erzeugung von Lautstärkekarten usw. Elektrische Feldanwendungen sind für die Entwicklung von Radarbildsystemen möglich. Nicht zuletzt für die geologische und astronomische Forschung erscheinen Interferenztheorien nützlich, um bessere Antennenanordnungen zu entwickeln und so die Messmöglichkeiten für verrauschte, kleine und weit entfernte Signale zu verbessern.
Es wurde klar: Nichts in der Natur ist ohne Grund. Selbst als virtuelles Radarbild erschiene der Homunkulus gespiegelt. Selbst als Radarbilder sind biologische Karten topografisch. Und selbst als (virtuelle, gepulste) Radarbilder verwendet die Natur Pulse in einer bestimmten Beziehung zur Übertragungsgeschwindigkeit. Auch die Eigenschaften zwischen Pulslänge und Pulsgeschwindigkeit sowie Schaltungsgeometrien (geometrische Wellenlänge) sind vergleichbar.
G. Heinz
[1] Alonso M., Finn, E.J.: Physics. Addison-Wesley Pub. Company 1970
[2] Baur, Erwin; Einführung in die Radartechnik. B.G. Teubner, Stuttgart, 1985
[3] Skolnik, M. I.; Introduction to Radar Systems. McGraw-Hill Book Company Inc., 1962
e-Mail: info@gheinz.de
Visitors since Dez. 6, 2021:
file created 08:04 Jan. 26, 1996
last revised 08:05 Jan. 26, 1996
stylesheet added and small redesign Jan. 30, 2024
revised July 30, 2025
Abb.2 added, Nov. 2025